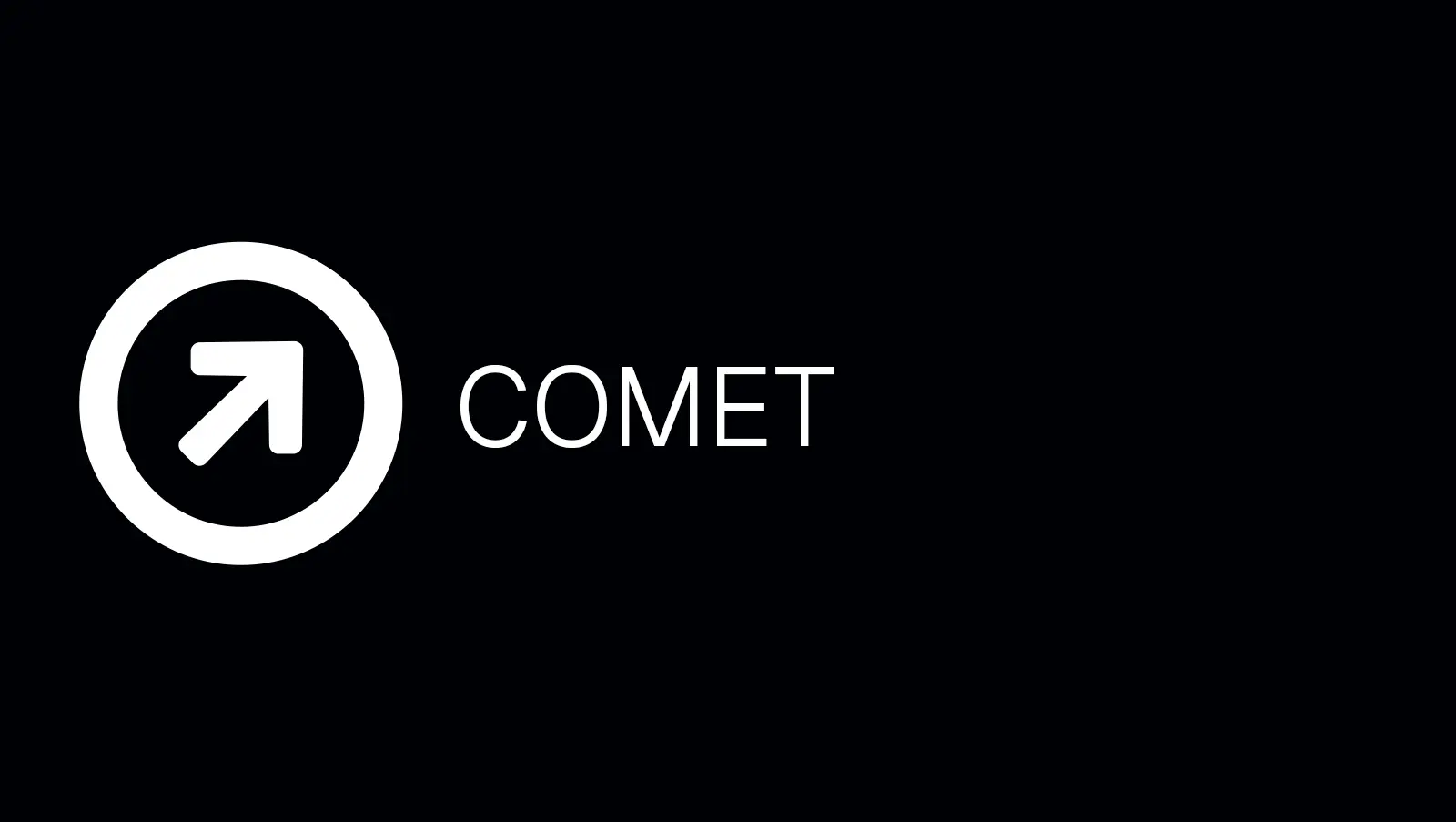„Wir benötigen einen politischen Anschub, um die Einführung und Verbreitung offener und sicherer Datenräume zu unterstützen.“
27. August 2025
Lesedauer:
7 Minuten
Das Fraunhofer IOSB-AST ist Teil der Fraunhofer Gesellschaft, die die international führende Organisation der angewandten Forschung ist. Als Innovationstreiber leitet das Institut strategische Initiativen zur Lösung künftiger Herausforderungen im Bereich der Angewandten Systemtechnik (AST) mit den Schwerpunkten auf Energie, Wasser und industrielle Anwendungen. Im Bereich Energiewirtschaft arbeitet das Institut u. a. an Systemanalysen, Datenökosystemen, digitalen Zwillingen und KI-gestützten Optimierungsverfahren für eine nachhaltige Energieversorgung. Oliver Warweg, verantwortlich für das strategische Business Development, spricht im Interview über die Rolle des Instituts als assoziierter Partner von SmartLivingNEXT, über datenbasierte Systemanalysen, Interoperabilität und darüber, warum die Nutzerperspektive künftig eine zentrale Rolle spielt.

Herr Warweg, was sind die aktuellen Forschungsschwerpunkte am Fraunhofer IOSB-AST im Bereich Energiewirtschaft, Systemanalysen und Datenökosysteme?
Am Fraunhofer IOSB-AST liegen unsere aktuellen Forschungsschwerpunkte in den genannten Bereichen insbesondere auf der Entwicklung und Anwendung innovativer digitaler Technologien. Ein zentrales Thema ist die Gestaltung und Implementierung von Data Spaces, die einen sicheren und souveränen Datenaustausch zwischen verschiedenen Akteuren der Energiewirtschaft, aber auch in Verbindung mit den Sektoren Mobilität, Smart Living und der Industrie ermöglichen. Im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) forschen wir an der Entwicklung fortschrittlicher Vorhersage- und Optimierungsverfahren für das Energiemanagement, um Flexibilitätspotenziale effizient zu nutzen und die Integration erneuerbarer Energien zu unterstützen. Dabei spielt generative KI aktuell eine sehr wichtige Rolle. Unser Ziel ist es, durch diese Ansätze die Digitalisierung und Sektorenkopplung in der Energiewirtschaft voranzutreiben und damit einen wichtigen Beitrag zur Energiewende zu leisten.
Was hat Sie motiviert, sich als assoziierter Partner bei SmartLivingNEXT zu engagieren?
Unsere Motivation liegt vor allem in der Chance, gemeinsam mit anderen Akteuren innovative Lösungen für die Sektorenkopplung zu entwickeln und zu erproben. Ein zentraler Aspekt ist dabei die Interoperabilität zwischen den entstehenden Datenökosystemen, die eine nahtlose Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Branchen ermöglicht. Besonders wichtig ist uns auch, das Vertrauen und die Akzeptanz beim Datenteilen zu stärken. Denn nur wenn alle Beteiligten bereit sind, relevante Daten sicher auszutauschen, können datenbasierte Geschäftsmodelle entstehen und damit ein Mehrwert für die beteiligten Akteure und die Endkunden.
Wo sehen Sie inhaltliche Schnittmengen zwischen Ihrer Arbeit und den Zielen des Forschungsprojekts SmartLivingNEXT?
Wir sehen zahlreiche inhaltliche Schnittmengen zwischen unserer Arbeit am Fraunhofer IOSB-AST und den Zielen von SmartLivingNEXT. Ein zentraler Aspekt sind Konzepte, die es Endkunden ermöglichen, als Prosumer energetische Flexibilität bereitzustellen und so aktiv am Energiesystem teilzunehmen. Ein weiteres gemeinsames Ziel ist die Konvergenz der technischen Grundlagen, um bestehende technische Hürden abzubauen und interoperable, offene Datenökosystem zu schaffen. Dies sind wichtige Schritte, um innovative Geschäftsmodelle zu ermöglichen und die Sektorenkopplung voranzutreiben.
Wie wichtig ist aus Ihrer Sicht die Interoperabilität technischer Systeme und welche Rolle spielen dabei offene Standards und Datenräume?
Interoperabilität technischer Systeme ist für uns ein entscheidender Erfolgsfaktor, um sektorübergreifend Innovation zu ermöglichen. Dabei geht es nicht nur um die technische Kompatibilität, sondern auch um die semantische Interoperabilität, somit um ein gemeinsames Verständnis der ausgetauschten Daten. Ebenso wichtig sind Aspekte wie Compliance, um rechtliche und regulatorische Anforderungen beim Datenaustausch einzuhalten, sowie die Interoperabilität unterschiedlicher Betreibermodell von Datenökosystemen. Offene Standards und Datenräume spielen hierbei eine zentrale Rolle: Sie schaffen die Basis für eine sichere, vertrauenswürdige und flexible Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen Akteuren und fördern die nachhaltige Entwicklung eines digitalen Ökosystems.
Welche Potenziale sehen Sie in der Verknüpfung von Gebäudetechnik, Energiesystemen und Nutzerverhalten?
In der Verknüpfung sehen wir großes Potenzial, insbesondere für die Versorgungssicherheit und die Dämpfung der Netzausbaukosten. Durch den lokalen Ausgleich von Erzeugung und Verbrauch können Lastspitzen reduziert und das Netz entlastet werden. Gleichzeitig eröffnet die aktive Einbindung der Endkunden neue Möglichkeiten, energetische Flexibilität zu nutzen und so auf volatile Erzeugung aus erneuerbaren Energien besser zu reagieren. Dadurch entsteht auch lokale Wertschöpfung, da Endkunden und lokale Energieversorger von ihrer Beteiligung am Energiesystem profitieren können.
Inwiefern berücksichtigen Ihre Modelle auch nutzerzentrierte Perspektiven – also tatsächliches Verhalten, Komfortansprüche oder Akzeptanz?
Unsere Modelle beziehen nutzerzentrierte Perspektiven in mehreren Aspekten ein. Das tatsächliche Verhalten der Nutzer wird bereits in unseren Vorhersagemodellen berücksichtigt, um realistische Prognosen zu ermöglichen. Komfortansprüche können grundsätzlich in den Optimierungsmodellen abgebildet werden, allerdings stehen solche Informationen bislang selten in ausreichender Qualität zur Verfügung. Um diese Funktionen optimal zu nutzen, ist es wichtig, die Akzeptanz der Endkunden für das Teilen ihrer Daten zu erhöhen. Hier setzen wir auf den Einsatz von Datenräumen, die einen sicheren und kontrollierten Datenaustausch ermöglichen. Wir erwarten, dass dadurch die Bereitschaft zum Datenteilen steigt und wir unsere Modelle weiter verbessern können, insbesondere im Hinblick auf individuelle Komfortansprüche.
Wie bewerten Sie den Einsatz von KI zur Optimierung von Energiesystemen auf Gebäude- oder Quartiersebene?
Den Einsatz von Künstlicher Intelligenz bewerten wir als sehr vielversprechend. KI wird bereits seit mehreren Jahren erfolgreich im Betrieb von Energiesystemen und im Energiemanagement eingesetzt. Allerdings erfordern klassische Ansätze oft umfangreiches Expertenwissen, langwierige Analysen und große Datenmengen, welche auf Gebäude und Quartiersebene noch nicht so umfangreich vorliegen. Insbesondere generative KI eröffnet hier neue Möglichkeiten: Sie kann Expertenwissen effizient einbinden, kommt auch bei geringer Datenlage zu erstaunlichen Ergebnissen und kann so schneller zu sehr guten Analyseergebnissen führen.
Wo sehen Sie noch Forschungsbedarf, um smarte und nachhaltige Lösungen künftig in die Breite zu bringen?
Ein wichtiger Aspekt ist die Vereinfachung der Einführung beziehungsweise Implementierung von Datenräumen, da deren Implementierung derzeit noch sehr komplex und aufwendig ist. Außerdem muss Interoperabilität nicht nur technisch, sondern vor allem auf semantischer Ebene gewährleistet werden, damit verschiedene Systeme und Akteure ein gemeinsames Verständnis der Daten entwickeln können. Schließlich sehen wir auch bei der Nutzungskontrolle weiteren Entwicklungsbedarf, um den Datenaustausch sicher, transparent und nach den Vorgaben der Endnutzer steuern zu können.
Abschließend: Was wünschen Sie sich von Politik, Forschung und Wirtschaft, um den Transfer in den Markt zu beschleunigen?
Um den Transfer in den Markt zu beschleunigen, wünschen wir uns von der Politik vor allem die zügige Umsetzung der EU-Richtlinien zur Etablierung von Energy-Sharing-Lösungen auf Quartiersebene. Diese schaffen die rechtlichen Grundlagen, damit lokale Energiegemeinschaften entstehen und wirtschaftlich arbeiten können. Von der Wirtschaft erwarten wir mehr Mut, gezielt in lokale Energieversorgungskonzepte zu investieren, um die Energiewende direkt zur Bevölkerung zu bringen. Unsere Forschungsergebnisse zeigen eindeutig, dass sich diese Investitionen wirtschaftlich lohnen und die lokale Wertschöpfung nachhaltig stärken. Datenökosysteme sehen wir als notwendigen IT- und Kommunikations-Backbone dieser Entwicklungen. Damit dieser Backbone seine volle Wirkung entfalten kann, braucht es allerdings noch etwas politischen Anschub, um die Einführung und Verbreitung offener, sicherer Datenräume zu unterstützen.
Artikel im Audio-Format:
Redaktion:
Ilka
Klein
Kategorie:
Leitprojekt
SmartLivingNEXT
Bleiben Sie informiert über die neuesten Entwicklungen rund um SmartLivingNEXT: